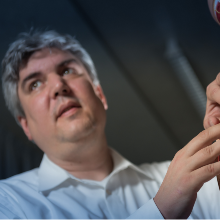Bewegungsabläufe sind in ihrem Zusammenspiel zwischen Nervensystem, Muskelzellen und kompletten Muskelgruppen nicht im Detail verstanden. Dreidimensionale Simulationen der Skelettmuskeln, wie sie von Biomechanikern der Universität Stuttgart erforscht werden, sollen das ändern – und helfen bei der Entwicklung von Ansteuerungen für Exoskelette und Neuroprothesen.
Der Griff zur Kaffeetasse am Morgen sieht so einfach aus. Die meisten schaffen das sogar im schlaftrunkenen Zustand. Doch was allein für diese Bewegung im menschlichen Körper ablaufen muss, ist keineswegs trivial. Damit die Hand nach der Tasse greift, muss das Gehirn den Ablauf in den Nervenzellen des Rückenmarks initiieren. Die elektrischen Signale erreichen dann über die Nervenfasern die so genannten motorischen Endplatten, die die Erregung auf die Muskelfasern der Skelettmuskeln weitergeben, die wiederum für willentliche Bewegungen verantwortlich sind. Dazu wird das elektrische Signal auf den Nervenfasern in eine mechanische Kraft umgewandelt: Kalzium-Ionen dienen als Botenstoff, der bestimmte Zellen zur Kontraktion anregt. Die mechanische Krafterzeugung auf Zellebene überträgt sich über die Muskeln an die Sehnen, mit dem Ergebnis, dass sich der Arm Richtung Tasse bewegt. Dann muss die Hand mit der genau richtig dosierten Kraft zugreifen, bevor die Bewegung der Tasse zum Mund erfolgt. Viele Muskelgruppen sind an diesem einfachen Ablauf beteiligt, gesteuert durch unzählige Nervenzellen. Wie komplex dieses Bewegungsmuster tatsächlich ist, wird immer dann besonders deutlich, wenn es durch Unfall- oder Krankheitsfolgen eingeschränkt ist, oder wenn Ingenieure versuchen, einem Roboter menschenähnliche Bewegungen beizubringen.
Neuromuskuläre Fragezeichen
Jede Bewegung beruht auf physikalischen und biochemischen Prozessen in den Zellen, die, bezogen auf komplette Muskelgruppen und in ihrem Zusammenspiel mit dem zentralen Nervensystem, bislang nicht gänzlich erforscht sind. Das will Oliver Röhrle, Professor für Kontinuums-Biomechanik und Mechanobiologie an der Universität Stuttgart, mit einem Team aus Experten verschiedener Fachrichtungen ändern. „Unser interdisziplinärer Ansatz zielt auf ein ganzheitliches Verständnis des neuromuskulären Systems ab“, so Röhrle. Simulationen sind dabei das Mittel der Wahl; mit im Boot sind darum Informatiker, Mathematiker und Visualisierungsspezialisten. Sportwissenschaftler, Elektrotechniker, Biologen und Physiologen stellen die Verbindung zu anwendungsbezogenen Fragestellungen her. Letztlich, sagt Röhrle, gehe es in ihrer Arbeit um die Frage, „wie Bewegung entsteht“.
„Mit der Elektromyografie, einer Art EKG für den Muskel, lassen sich die elektrischen Gesamtpotenziale solcher Bewegungen messen, zum Beispiel an der Oberfläche von Arm oder Bein“, erläutert der Mathematiker. „Auf diese Weise bekommen wir aber nur stark verrauschte Signale und tun uns schwer, davon ausgehend auf einzelne muskuläre Abläufe rückzuschließen.“ Gerade beim Oberschenkel kommt die Elektromyografie an ihre technischen Grenzen, weil sie nur ein bis zwei Zentimeter tief messen kann – muskulär so richtig interessant wird es allerdings erst darunter. „Wir wollen mit realistischen Simulationen der Bewegungen und der elektrischen Potenziale deutlich tiefer kommen und so Ergebnisse liefern, die die Kolleginnen und Kollegen dann validieren können“, sagt Röhrle.
Neuronale Ansteuerung im Modell
Seine Arbeitsgruppe rechnet mit dreidimensionalen Skelettmuskelmodellen und geht bei der Simulation nach dem Schema vor: „Aktivierung rein, Bewegung raus“. Diese Modelle sind sehr detailliert, berücksichtigen also eine hohe Zahl an Muskelfasern und deren neuronale Ansteuerung. „Unter den vielleicht 20 Forschungsgruppen weltweit, die Skelettmuskeln dreidimensional modellieren, sind wir die einzigen, die so verfahren“, erläutert der Wissenschaftler. Noch ist es Grundlagenforschung, aber künftig werden Simulationen in verschiedenen Bereichen davon profitieren, so etwa die Sportwissenschaften. Aber auch für die möglichst natürliche Anbindung von Prothesen oder für Crashtests könnten die Ergebnisse hilfreich sein.
Ein Beispiel für ein Forschungsprojekt, das bereits näher an der Anwendungsreife ist, heißt KONSENS NHE. Hier sind neben Röhrles Team auch das Universitätsklinikum und die Universität Tübingen sowie die Hochschule Reutlingen beteiligt. Ziel des 2017 begonnenen, auf drei Jahre angelegten Projekts ist ein alltagstaugliches Exoskelett für die Hand, das sich über die Nerven steuern lässt. „Bei der Entwicklung dieser Orthese haben wir die Situation von Schlaganfallpatienten vor Augen, die häufig Bewegungseinschränkungen der Gliedmaßen haben, dauerhaft oder vorübergehend“, sagt Dr. Leonardo Gizzi, der in Röhrles Team für das Projekt verantwortlich zeichnet. Die Orthese soll dafür sorgen, dass ein Schlaganfallpatient zum Beispiel wieder fest genug greifen und die Hand uneingeschränkt bewegen kann. Als Ausgangspunkt diente der Demonstrator eines hirngesteuerten Hand-Exoskeletts, der von einem internationalen Team unter Führung der Universität Tübingen entwickelt worden war. Damit gelang es, die Funktion der Hand bei Querschnittsgelähmten fast vollständig wiederherzustellen. Allerdings war dieses Exoskelett nicht mobil nutzbar und sein Einsatz erforderte geschultes Personal. Das aktuelle Projekt soll deswegen ein tragbares, alltagstaugliches Exoskelett hervorbringen: Ist ein Schlaganfallpatient zum Beispiel halbseitig gelähmt, soll er es selbst anlegen können.
Patient und Orthese kommunizieren miteinander
Um sicher zugreifen zu können, würde das Exoskelett idealerweise mittels gemessener Hirnströme gesteuert, kombiniert mit Augenbewegungen und einer dreidimensionalen Erkennung von Gegenständen. „Für Patienten, deren Muskeln an den Händen noch aktiv sind, die aber nicht genügend Kraft aufbringen können, um sicher zu greifen, nutzen wir elektromyografische Elektroden“, erklärt Gizzi. Mit solchen Elektroden lässt sich die natürlich auftretende elektrische Spannung im Muskel erfassen. Die Signale sind, wenn man so will, auch die direkte Verbindung zu den Forschungsarbeiten in Röhrles Team zu den Simulationen der Skelettmuskelbewegungen. „Die Orthese empfängt jedoch nicht nur Steuersignale vom Patienten, sondern gibt ihm auch ein haptisches Feedback über Vibrationsmotoren“, fährt Gizzi fort. So soll ein möglichst natürlicher Umgang mit dem Exoskelett ermöglicht werden.
Derzeit entstehen im Projekt Hardware und elektronische Steuerung, Gizzi ist für die Auslegung der elektromyografischen Elektroden am Unterarm zuständig. „Wir suchen die optimale Anordnung mit möglichst wenigen Sensoren“, sagt der Wissenschaftler. Dann folgen umfangreiche Funktionstests, zunächst mit gesunden Probanden. Sobald die Projektbeteiligten soweit sind, dass sie die Orthese testweise einem Patienten anlegen können, geht die Arbeit erst richtig los: „Das wird eine entscheidende Phase, denn letztlich können uns nur Betroffene sagen, wie sie den Umgang mit der Orthese erleben“, verdeutlicht Gizzi. „Aussehen, Gewicht, Bedienung – all das wird mit hineinspielen und sich womöglich stark von unseren Erwartungen unterscheiden.“ Dann geht es nicht mehr nur um Technik und Funktion, wie Gizzi mit einem Vergleich zur Prothetik erläutert: „Dort hat man häufig die Erfahrung gemacht, dass ältere Patienten sich einen möglichst natürlich aussehenden künstlichen Ersatz wünschen, während für Kinder eine Prothese nicht roboterhaft und technisch genug aussehen kann.“